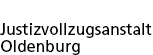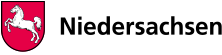Bildrechte: grafolux & eye-server
Bildrechte: grafolux & eye-serverOpferschutz und Täterverantwortung
Vorschläge für Vernetzung und Kooperation zwischen Opferhilfe und Justizvollzug
Ermittlung1
Opferschutz-Täterverantwortung-Untersuchung
Opferschutz-Täterverantwortung-Strafhaft
Die behördenübergreifende Konzeption wurde aus der Überlegung heraus entwickelt, das Risiko bei gewährten Vollzugslockerungen pp. zu minimieren und Institutionen und Behörden außerhalb des Vollzuges zu involvieren. Ursprung war das Anliegen der Justizvollzugsanstalt Oldenburg, die Gewährung von Vollzugslockerungen für Strafgefangene konzeptionell zu erweitern und auch die Interessen und Befürchtungen der Öffentlichkeit, insbesondere den Opferkontext, zu berücksichtigen. Seit Juni 2001 nehmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 19 Institutionen (s. Anlage) der Stadt und des Landkreises Oldenburg an Treffen des Arbeitskreises in der Justizvollzugsanstalt Oldenburg teil, dessen Ergebnis hier vorgestellt werden soll.
Die Konzeption von "Opferschutz und Täterverantwortung" verfolgt primär präventive Ziele. Zunächst sollen aktuelle Opfer, deren Angehörige oder Zeugen (im Folgenden aus Gründen der Vereinfachung kurz "Opfer" genannt) vor Übergriffen der Täter ge-schützt werden. Im Weiteren sollen auch zukünftige Taten, z. B. auch im Zusammenhang mit Vollzugslockerungen, verhindert werden. Hierbei muss auch auf das subjektive Empfinden einer Bedrohung eingegangen werden.
Sekundär sollen örtliche Netzwerke gestärkt und der Informationsfluss verbessert werden.
Vieles in dieser Zusammenfassung beschreibt die bereits praktizierten Arbeitsweisen in ihren Zusammenhängen, vieles entspricht aber auch einer Zielformulierung, die erst noch umgesetzt werden muss. Dieses Arbeitsergebnis soll in erster Linie zur Diskussion anregen, sie möchte aber auch die Umsetzung einfordern.
Im Rahmen der ersten Ermittlungen sind die Bediensteten der Polizei die wichtigsten Ansprechpartner für die Opfer.
Die Merkblätter für die Opfer über ihre Rechte sollten zum besseren Verständnis umformuliert werden. Neben diesen Belehrungen sollten die Opfer ferner noch über die örtlichen Opferhilfeinstitutionen informiert werden, die dann nach eigenem Ermessen aufgesucht werden könnten.
Darüber hinaus sollten die Opfer befragt werden, ob und in welcher Form sie weitere Informationen über den Verbleib des Täters wünschen, bzw. wie sie in Zukunft diese Informationen erhalten möchten. Dieser kurze Fragebogen sollte dann dem örtlich zuständigen Opferhilfebüros zugeleitet werden.
Die gewonnen Erkenntnisse müssen dann auch Einfluss auf die Vollzugsplanung finden. Priorität hat jedoch immer der Standart der Freiwilligkeit und der Wahlmöglichkeit des Opfers – Opfer sollen nie direkt vom Vollzug ohne deren Einverständnis kontaktiert werden.
Wurde der Täter inhaftiert, soll neben dem obligatorischen Aufnahmeverfahren eine "Zuführung" zu einer Beratung erfolgen (in den Fällen von körperlicher Gewalt und Missbrauch) um einen verharmlosenden Effekt zu verhindern und dem vermeintlichen Täter seine Verantwortung bewusst zu machen. Die im Vollzug bekannte Neukonstruktion: "Sagen sie einfach, sie seien wegen Betruges hier", darf es nicht ge-ben. Außerdem muss die Beratung des Täters bereits von der Untersuchungshaft bis zur Strafhaft durchgängig organisiert und frühzeitig begonnen werden.
Daneben soll eine "freie" Beratungsstelle neu eingerichtet werden, an die sich die Täter selbst wenden können. Ebenso muss der Zugang zu einer Organisation, die den Täter-Opfer-Ausgleich anbietet gewährleistet sein.
Das Resultat der zugewiesenen Beratung kann dann ebenso wie das Ergebnis des Täteropferausgleichs (TOA) und den Ermittlungen der Polizei etc. in das Ergebnis der Verhandlung einfließen, wobei insbesondere die persönliche Einsicht und die Struktur des Täters erkennbar werden könnte, sich mit der Straftat und ihren Folgen auseinander zu setzen.
Das Urteil soll dann nicht nur dem Justizvollzug für die weitere Vollzugsplanung zur Verfügung gestellt werden, sondern auch der Polizei für ihre weitere Ermittlungstätigkeit und dem Jugendamt für die weitere Ausgestaltung der Betreuungsarbeit mit den Opfern und deren Angehörigen.
Hierbei sind diese Bestrebungen zunächst mit datenschutzrechtlichen Bestimmungen abzugleichen.
Innerhalb der Strafhaft werden über den Täter eine Vielzahl an Informationen gesammelt und an Erkenntnissen gewonnen. Diese Informationen sollen nicht nur die Behandlung im Vollzug leiten, sondern auch der Bewährungshilfe, der Polizei, dem Jugendamt, der Staatsanwaltschaft und den Opferhilfebüros jeweils auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.
Der Datenschutz bietet zur Zeit die Möglichkeit, im Rahmen des Schutzes der Allgemeinheit personenbezogene Daten dann weiterzuleiten, wenn Gefahr im Verzuge ist. Das kann zum Beispiel dann der Fall sein, wenn Erkenntnisse vorliegen, dass das Opfer bedroht wird oder gar Straftaten gegen das Opfer geplant sind.
Daneben können die Opfer selbst über die Opferhilfebüros gem. des Erlasses d. MJ (4510 – 305.44) Informationen zur Unterbringung der Täter erfragen.
Opferschutz-Täterverantwortung-Untersuchung
Der Prozess dieser Informationsabfrage stellt sich in der Untersuchungshaft wie folgt dar: Vor Erhebung eines Haftbefehls ist die Polizei der wichtigste Ansprechpartner für das Opfer und kann unverzüglich über die Verhängung eines Haftbefehls oder die Freilassung aus der Polizeihaft informieren. Nach Verkündung eines Haftbefehls wenden sich die Opfer mit ihrer Fragestellung an das Opferhilfebüro. Von dort wird beim zuständigen Gericht der Sachstand erfragt. Das Opfer selbst hat dann die Mög-lichkeit, weitere Schritte mit einer Konfliktschlichtungsstelle, einer Opferhilfeorganisation oder einer Behörde zu vereinbaren.
Opferschutz-Täterverantwortung-Strafhaft
Innerhalb der Strafhaft sind andere Wege zu beschreiten. Hier wendet sich das Opfer zunächst auch an das Opferhilfebüro, das bei der Vollstreckungsbehörde, den Ort des Vollzuges abfragt. Dort erhebt das Opferhilfebüro weitere Informationen, die es den Betroffenen zurückmeldet. Das Opfer selbst kann sich im Folgenden an die zu-ständige Behörde oder Beratungsstelle wenden.
Die Justizvollzugsanstalten können sich jedoch auch ihrerseits mit den Opferhilfebüros ins Benehmen setzen, wenn während oder vor Erstellung eines Vollzugsplanes Zweifel an einer möglichen Bedrohungssituation bestehen.
Darüber hinaus sollten sich die Justizvollzugsanstalten selbst an die o. a. Behörden oder Beratungsstellen wenden, falls aus ihrer Sicht ein Opferinteresse besteht, um die Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen nicht zu gefährden.
Zunächst sollte vor jeder Erstellung eines Vollzugsplanes, die für den Täter zuständige Polizeidienststelle und die zuständige Staatsanwaltschaft zum Thema "Opfersituation und Bedrohung" gehört werden.
Kehrt man zur Ausgangsfrage, "Umgang mit Inhaftierten bei Vollzugslockerungen und Entlassung", zurück, kann festgestellt werden, dass den Opferhilfebüros eine zentrale Rolle bei der Knüpfung von Netzwerken und der Initiierung von Informati-onswegen zukommt. Dem Opfer steht selbstverständlich der Weg zu allen Opferhilfe-institutionen offen, wobei die Opferhilfebüros mit allen beteiligten Einrichtungen ko-operieren müssen – die zentrale Rolle im Vernetzungsprozess verbleibt jedoch bei den Opferhilfebüros.
 Bildrechte: grafolux & eye-server
Bildrechte: grafolux & eye-server